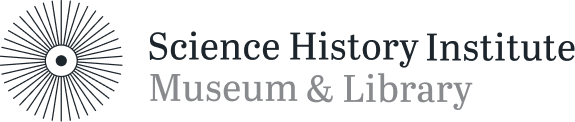Review by R.F. Fuchs of Georg Bredig's "Anorganische Fermente"
- 1902

Rights
Download all 6 images
PDFZIPof full-sized JPGsDownload selected image
Small JPG1200 x 1823px — 374 KBLarge JPG2880 x 4375px — 1.7 MBFull-sized JPG2931 x 4452px — 1.7 MBOriginal fileTIFF — 2931 x 4452px — 37.4 MBR.F. Fuchs’ handwritten 1902 article in the Biologisches Centralblatt examines the similarities between colloid solutions and enzymes, with a focus on experiments conducted by Georg Bredig (1868-1944) and colleagues.
Published in Germany from 1881-1981, the Biologisches Centralblatt was one of the earliest and most influential biological journals and covered a wide range of topics in biology, such as botany, zoology, microbiology, and physiology.
| Property | Value |
|---|---|
| Author | |
| Addressee | |
| Place of creation | |
| Format | |
| Genre | |
| Extent |
|
| Language | |
| Subject | |
| Rights | In Copyright - Rights-holder(s) Unlocatable or Unidentifiable |
| Credit line |
|
| Additional credit |
|
| Digitization funder |
|
Institutional location
| Department | |
|---|---|
| Collection | |
| Series arrangement |
|
| Physical container |
|
Related Items
Cite as
Fuchs, R.F. “Review by R.F. Fuchs of Georg Bredig's ‘Anorganische Fermente,’” 1902. Papers of Georg and Max Bredig, Box 1, Folder 43. Science History Institute. Philadelphia. https://digital.sciencehistory.org/works/nbk5ls5.
This citation is automatically generated and may contain errors.
Image 1
Biologisches Centralblatt 1902. Nr. 1 / XXII. 1. Jan.
Es könnte beinahe den Anschein gewinnen, als sollten wir in ein Stadium der Lehre von den Fermentwirkungen eintreten, welches eigentlich nur eine Rückkehr bedeutet zur Berzelius‘schen, vor allem aber zu der von Schönbein geschaffenen Lehre der Katalyse, welche von Ostwald in exakter Weise neugestaltet wurde. Bredig hat in seiner sehr wertvollen und originellen Arbeit zunächst die Eigenschaften der kolloidalen Lösungen übersichtlich dargestellt, welche in mancher Beziehung Ähnlichkeit mit denen der Fermente bieten. Ferner hat Bredig die sehr interessanten Eigenschaften der von ihm durch elektrische Kathodenzerstäubung direkt aus Wasser und Metall erhaltenen kolloidalen Sole (d. h. nach Graham flüssige Kolloide) von
Image 2
(page 2)
von Gold, Platin, Iridium, Palladium, Silber und Kadmium genauer studiert. Hier interessieren uns vor allem die Untersuchungen, welche Bredig gemeinsam mit Müller von Berneck, Ikeda und Reinders ausgeführt hat, welche zeigen sollen, dass die Kontaktwirkung der Metalle dieselbe ist wie die der organischen Fermente. Durch die Verwendung des elektrisch hergestellten Platinsol war es möglich, beim Studium der Katalyse die Platinmeng zu dosieren und äußerst fein zu verteilen und zu verdünnen, so dass die Messungen über den zeitlichen, quantitativen Verlauf der Platinkatalyse des Wasserstoffsuperoxydes ausgeführt werden konnten. Unzweifelhaft giebt es eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten zwischen Fermenten und Katalysatoren, von denen die auffallendste die Zersetzung des H2O2 ist. Geht doch Schönbein so weit, diese Zersetzung
(page 3)
als das „Urbild aller Gärungen" zu bezeichnen. Nach Bredig und seinen Mitarbeitern zeigen nun die hergestellten Metallsole ein ganz ähnliches Verhalten gegen H2O2 wie die Fermente, weshalb diese Metallsole als ,,anorganische Fermente“ bezeichnet werden, da sie außerdem noch den kolloidalen Zustand mit den Fermenten gemeinsam haben. Es sind nach Bredig's eigenen Worten ,,anorganische Modelle der organischen Enzyme“. Um die Zulässigkeit dieser Bezeichnung und ihre Bedeutung zu würdigen, müssen wir zweierlei berücksichtigen: Ist die katalytische Fähigkeit der Fermente, namentlich ihr Verhalten gegen II,O, eine wesentliche Eigenschaft der Fermente, und wird die typische Fermentwirkung vernichtet, wenn die die H2O2 katalysierende
Image 3
(page 4)
Kraft des Enzyms gestört wird? Die Untersuchungen Schönbeins, sowie insbesondere sowie insbesondere die von Jakobson haben gezeigt, dass man den Fermenten die Fähigkeit H2O2 zu katalysieren nehmen kann, ohne dass dadurch die typische Fermentwirkung des Emulsin und Trypsin verloren geht. Infolgedessen handelt es sich um zwei Eigenschaften der Enzyme, welche nicht untrennbar miteinander verknüpft sind. Also ist die Fähigkeit der Fermente H2O2 zu katalysieren keine solche, an welche die enzymatische Funktion gebunden erscheint, mithin ist sie für den Fermentprozess nicht wesentlich. Außerdem müsste erst noch der Beweis erbracht werden, dass alle Enzyme H2O2 katalysieren, wenn wir diese Eigenschaft als eine für die Fermente typische
(page 5)
betrachten wollen, wobei noch dem Umstande Rechnung getragen werden muß, daß die Reindarstellung der Fermente noch nicht gelungen ist. Die zweite Frage ist die nach der kolloidalen Struktur der Fermente. Um sie zu beantworten, müssten wir gleichfalls die Fermente rein dargestellt haben; wir haben aber stets enzymhaltige Eiweißlösungen vor uns, welche Kolloide sind. Darum müssen aber die Enzyme noch nicht Kolloide sein, wenn gleich es auch sehr wahrscheinlich ist, da wir sie als den Nucleoalbuminen nahestehende Körper betrachten. Trotzdem muss aber immer wieder hervorgehoben werden, dass ein strikter Beweis für diese Annahme noch nicht erbracht worden ist, weshalb wir noch nicht berechtigt sind, diesen Punk als wesentliches Kriterium anzusprechen. Sehr interessant sind die Versuche über die Vergiftungs-
Image 4
(page 6)
-(Lähmung-)Erscheinungen der katalytischen Kraft der Platin- und Goldsolen, welche vielfach die gleichen Ergebnisse liefern wie analoge Versuche an Fermenten. Aus der großen Reihe der untersuchten Substanzen sei nur die nachstehende Zusammenstellung erwähnt. Die lähmende Wirkung auf die Platinkatalyse ist noch merklich bei Zusatz von:
0,0000001 g-Mol. H 2 S pro Lit.
0,00000005 HCN
0,00000005 JCN
0,0000001 J 2
0,00004 Br 2
0,00004 NH 2 OH
0,00018 C 6 H 5 NH 2
0,00004 P 4
0,00024 PH 3
0,001 C 2 4 H 2
0,0000001 HgCl 2
(page 7)
0,0048 HgCy 2 ,,
0,002 Na 2 S0 4
0,0002 Na 2 S. 2 3
0,0003 HC1
Besonders bemerkenswert Lähmungen auch bei der Buchner’schen Zymase bezüglich des Alkoholgärungsvermögens vorfinden; ferner zeigen sich jene Stoffe, welche als Blutgifte (Kobert) sehr wirksam sind, von ähnlichem Einfluss auf das H2O2 Zersetzungsvermögen des Platinsol. Eine Ausnahme macht KC103, welches die Platinkatalyse gar nicht verändert. Aber auch den vorläufigen Untersuchungen von Schaer, so wie von Kobert wird auch die katalytische Kraft des Blutes durch KC103 nicht verändert, woraus folgt, dass das Oxyhaemoglobin nicht der H2O2 Katalysator des Blutes
Image 5
(page 8)
sein dürfte. Eine Vergleichung des lähmenden Einflusses verschiedener Agentien auf die Blut- und Platinkatalyse des H2O2 , welche durch die vorläufigen Untersuchungen Schaer's möglich wurde, ergiebt keine volle Übereinstimmung der erzielten Wirkung. Es muss aber die ausführliche Publikation Schaer's abgewartet werden; vielleicht wird sich bei Berücksichtigung der von Bredig erhobenen Einwände eine größere Übereinstimmung ergeben. Die Lähmung der Platinkatalyse durch gewisse Substanzen, z.B. HCN, kann nach Durchlüftung wieder zum Verschwinden gebracht werden, ähnliche Erholungserscheinungen finden sich auch bei einigen Fermenten. Da die Reaktionen der kolloidalen Katalysatoren an ungeheuer entwickelten Oberflachen stattfinden, so hält es Bredig für
(page 9)
,,durchaus wahrscheinlich, daß ähnliches auch bei den Wirkungen der Fermente, Enzyme, Blutkörperchen und oxydierenden und katalysierenden Organgeweben vorliegt. Wir sehen also, dass der Organismus nicht nur deshalb seine ungeheuren Oberflächen in den Geweben und kolloidale Fermenten entwickelt, weil er osmotische Vorgänge braucht, sondern auch wegen der möglichst großen katalytischen Wirksamkeit solcher Oberflächen. Wenn also Boltzmann sagt, dass der Kampf der Lebewesen ums Dasein ein Kampf um die freie Energie sei, so ist von allen Energieart jedenfalls die freie Energie der Oberflächen fuer den Organismus eine der wichtigsten.“ Um eine solche Begründung für die Strukturverhältnisse der Organismen abgeben zu können, dazu bedürfte
Image 6
(page 10)
es viel eingehenderer Studien, denn das große Rätsel, warum das lebende Protoplasma mit einer solchen Fülle von höchst komplizierten physikalischen und chemischen Eigenschaften ausgestattet ist, ist ein zu schwieriges, als dass es so nebenbei gelost werden könnte. Die bei der Differenzierung organischer Gebilde in Frage kommenden Bildungsfaktoren sind zu mannigfaltiger Art; denn hier sind nicht nur einfache physikalische und chemische Momente in Rechnung zu ziehen, sondern Vererbung, Anpassung an Funktionen, deren materielle Vorgänge uns noch vielfach ganz unbekannt sind, kommen mit in Frage, so dass eine jede einseitige Argumentation nach dieser Richtung hin keine Aussicht auf Erfolg haben kann. Übrigens wissen
(page 11)
wir noch gar nicht, in welchem Umfange katalytische Prozesse fuer den Lebensprozess von Bedeutung sind, so dass wir heute schon gezwungen sein sollten, eine direkte funktionelle Anpassung der Organismen an diese Prozesse anzunehmen. Immerhin wird aber die Entwicklungsmechanik, welche allen differenzierenden Momenten Rechnung zu tragen hat, auch die freie Energie der Oberflächen in den Kreis ihrer Betrachtungen mit einbeziehen müssen, um im geeigneten Falle sie als Differenzierungsfaktor anzusehen. Der Physiologie fällt aber die wichtige Aufgabe zu, die Bedeutung der Katalyse fuer den Bestand des Lebens zu erforschen, erst dann kann die Entwicklungsmechanik ihren gestaltenden Einfluss ermitteln.
R.F. Fuchs (Erlangen).
Image 1
Biological Central Journal 1902. No. 1 / XXII. January 1st
It may almost seem as if we are about to enter a stage in the study of enzyme effects that represents a return to the Berzeliusian theory, particularly to the doctrine of catalysis created by Schönbein, which was accurately reconfigured by Ostwald. In his valuable and original work, Bredig provided a clear overview of the properties of colloidal solutions, which share similarities in some respects with enzymes.
Furthermore, Bredig studied in detail the very interesting properties of the colloidal sols (i.e. liquid colloids according to Graham) of
Image 2
(page 2)
gold, platinum, iridium, palladium, silver and cadmium that he obtained directly from water and metal through electric cathode sputtering. Here, we are mainly interested in the investigations that Bredig conducted jointly with Müller von Berneck, Ikeda, and Reinders, which were intended to show that the contact effect of metals is the same as that of organic enzymes. By using electrically produced platinum sol, it was possible to precisely measure and dilute the amount of platinum during the study of catalysis, so that measurements of the temporal and quantitative course of platinum catalysis of hydrogen peroxide could be carried out. Undoubtedly, there are a whole series of similarities between enzymes and catalysts, of which the most striking is the decomposition of H2O2. Schönbein even goes so far as to describe this decomposition as the “prototype of all fermentations.”
(page 3)
According to Bredig and his colleagues, the prepared metal sols exhibit a very similar behavior towards H2O2 as the enzymes, which is why these metal sols are referred to as “inorganic enzymes” since they also share the colloidal state with the enzymes. In Bredig’s own words, they are "inorganic models of organic enzymes.” In order to appreciate the validity of this designation and its significance, we must consider two things: Is the catalytic ability of enzymes, especially their behavior towards H2O2, a fundamental property of enzymes, and is the typical enzyme action destroyed when the enzyme's H2O2-catalyzing power is disrupted?
Image 3
(page 4)
Schönbein’s investigations, particularly those of Jakobson, have shown that the ability of ferments to catalyze H2O2 can be removed without losing the typical fermenting effect of emulsion and trypsin. As a result, these two properties of the enzymes are not inextricably linked. Therefore, the ability of ferments to catalyze H2O2 is not attached to the enzymatic function and is not essential to the fermenting process. Furthermore, it would first have to be proven that all enzymes catalyze H2O2
(page 5)
if we want to consider this property as typical for ferments, taking into account the fact that the pure isolation of ferments has not yet been achieved. The second question is that of the colloidal structure of the ferments. In order to answer it, we would also have to represent the ferments purely. However, we always have albumen solutions containing enzymes before us, which are colloids. Therefore, the enzymes need not yet be colloids, although it is very probable that they are, since we regard them as bodies close to the nucleoalbumins. Nevertheless, it must be emphasized again and again that strict proof for this assumption has not yet been provided. That is why we are not yet entitled to address this point as an essential criterion.
Image 4
(page 6)
The experiments on the poisoning (paralysis) phenomena of the catalytic power of platinum and gold sols are very interesting, as they often yield the same results as analogous experiments on ferments. Out of the large number of substances examined, only the following summary should be mentioned: the paralyzing effect on platinum catalysis is still noticeable with the addition of the following substances:
0,0000001 g-Mol. H 2 S pro Lit.
0,00000005 HCN
0,00000005 JCN
0,0000001 J 2
0,00004 Br 2
0,00004 NH 2 OH
0,00018 C 6 H 5 NH 2
0,00004 P 4
0,00024 PH 3
0,001 C 2 4 H 2
0,0000001 HgCl 2
(page 7)
0,0048 HgCy 2 ,,
0,002 Na 2 S0 4
0,0002 Na 2 S. 2 3
0,0003 HC1
Notable paralysis can be found in Buchner's zymase regarding its ability to ferment alcohol. Moreover, substances that are highly effective as blood poisons (Kobert) exhibit a similar influence on the H2O2 decomposition power of the platinum sol. An exception to this is KC103, which has no effect on the platinum catalysis at all. However, the preliminary investigations by Schaer and Kobert demonstrate that the catalytic power of the blood is not changed by KC103. This suggests that oxyhemoglobin should not be the H2O2 catalyst of the blood.
Image 5
(page 8)
A comparison of the paralyzing influence of various agents on blood and platinum catalysis of H2O2, made possible by Schaer's preliminary investigations, does not result in full agreement of the effect achieved. However, we must await Schaer's detailed publication, and perhaps, if Bredig’s objections are taken into account, there will be greater agreement. The paralysis of platinum catalysis by certain substances, such as HCN, can disappear after aeration, and similar signs of recovery can also be found with some ferments. Since the reactions of the colloidal catalysts take place on enormously developed surfaces, Bredig considers them to be:
(page 9)
„quite probable that something similar also occurs in the effects of ferments, enzymes, blood cells, and oxidizing and catalyzing organ tissues. We see, therefore, that the organism develops its enormous surfaces in tissues and colloidal ferments not only because it needs osmotic processes, but also for the greatest possible catalytic effectiveness of such surfaces. Therefore, when Boltzmann says that the struggle for existence among living beings is a struggle for free energy, the free energy of surfaces is certainly one of the most important energy types for the organism.”
Image 6
(page 10)
In order to provide a justification for the structural relationships of organisms, much more detailed studies are required. The great enigma of why living protoplasm is equipped with such a wealth of extremely complicated physical and chemical properties is too difficult to solve in a straightforward manner. The formation factors involved in the differentiation of organic structures are numerous; not only simple physical and chemical factors need to be taken into account, but inheritance, adaptation to functions, and material processes, which are often completely unknown, also come into question. Therefore, any one-sided argument in this direction has no prospect of being successful.
(page 11)
Currently, we do not yet know to what extent catalytic processes are important for life processes. Therefore, we must assume that organisms have a direct functional adaptation to these processes. However, the mechanics of development must take into account all differentiating moments, including the free energy of the surfaces, in order to view it as a differentiation factor in appropriate cases. Physiologists have the important task of investigating the importance of catalysis for the existence of life. Only then can development mechanics determine its formative influence.
R.F. Fuchs (Erlangen).